 Beiträge zur Geschichte der Steinkreuze
Beiträge zur Geschichte der Steinkreuze Beiträge zur Geschichte der Steinkreuze Beiträge zur Geschichte der Steinkreuze |
Zu der altgermanischen Einrichtung des Wergeldes kam mit der Einführung des Christentums für einen Totschlag noch
eine Reihe kirchlicher Bußen, mit denen die Untat auch nach kirchlicher Ansicht gesühnt werden sollte. Solche Auflagen bestanden u.a. in Seelenmessen, Wallfahrten
nach Rom und Aachen, gemeinsamen Bußzügen des Täters mit einer bestimmten Anzahl von Begleitern. Die meisten dieser Auflagen dienten dem Seelenheil des
Getöteten, der ja ohne geistliche Absolution aus dem Leben geschieden war.
Aus der immerhin großen Zahl der erhaltenen Sühneverträge kennen wir diese Begleitumstände hinreichend genau. An diesen Verträgen
erscheint häufig auch die Verpflichtung, ein steinernes Kreuz setzen zu lassen, und zwar entweder am Tatort oder an einem anderen Ort, wo es die Hinterbliebenen
haben wollten.
Diese steinernen Kreuze der Sühneverträge sind die Sühnekreuze1) und Kreuzsteine,
die man allenthalben in Feld und Flur antrifft, in einigen Gegenden häufiger, in anderen seltener. Um fast jedes dieser Kreuze rankt sich eine Sage, die im Kern fast
immer an eine Bluttat erinnert, und die Mehrzahl dieser Male verdankt auch einer Blutsühne ihr Entstehen, doch bei weitem nicht alle; denn ein großer Teil war nur
Andachtsbild oder Grenzzeichen und nur selten können wir entscheiden, aus welchem Grund ein derartiges Kreuz aufgestellt worden ist.
Aus dem Ort der Aufstellung kann man wenig auf die Art des Males schließen. Die Kreuze abseits der Straße oder an einer Grenze geben
im allgemeinen wohl den Ort der Tat an. Die an Straßen oder an Kreuzwegen dagegen können Andachtsbilder sein, aber auch solche Sühnemale, die da auf Wunsch
der Hinterbliebenen aufgestellt worden sind. Es war ehedem Sitte, daß die Vorübergehenden an Kreuzen ein kurzes Gebet sprachen. Diese Gebete sollten den
Verstorbenen eher aus dem Fegefeuer befreien und je mehr Gebete für ihn gesprochen wurden, desto eher wurde er erlöst. Deshalb setzte man die Kreuze an die
belebten Verkehrswege.
Die Ansichten über das Alter des Brauches der Sühnekreuze gehen sehr auseinander. Einige bezeichnen ihn als uralt und vorchristlich.
Dafür wären die Beweise noch zu liefern. Andere halten ihn für mittelalterlich und führen dafür die Urkunden und auch technische Gründe an.
Die ältesten Sühneverträge, in denen steinerne Kreuze genannt sind, stammen erst aus der Zeit nach 1350. Das älteste datierte Steinkreuz
ist das Markuskreuz vom Göttinger Leinebusch (jetzt im Städtischen Museum). Die Inschrift darauf gibt wohl die Zeit, den 25. April 1260, an, jedoch nicht den Grund.
Es war vermutlich eines jener Kreuze, die nach einer Vorschrift des Papstes Leo III. vom Jahre 779 an Straßen und Wegkreuzen aufgestellt werden sollten.
Das Erlöschen des Brauches fällt in das frühe 16. Jahrhundert. Der Ewige Reichslandfrieden und die Halsgerichtsordnungen schafften die
Bußen ab und setzten dafür Strafen fest. Wergeld, christliche Sühnen und das Setzen der Kreuze hatten damit keinen Sinn mehr. Dafür trat das Steinkreuz als
Erinnerungsmal auf.
Das Erinnerungsmal hält allgemein die Erinnerung an einen Unglücksfall fest. Als solches wurde es schon gleichzeitig mit den Sühnesteinen
errichtet und wird es noch in der Gegenwart gesetzt. Eine Abart dieser Erinnerungsmale sind die "Mordsteine“, die entweder an der Stelle der Tat oder dort, wo der
Ermordete gefunden wurde, errichtet wurden und noch errichtet werden.
Der Unterschied zwischen Sühnestein und Erinnerungsmal ist der: das Sühnemal mußte der Täter setzen, das Erinnerungsmal lassen
die Hinterbliebenen aufrichten.
Die Hauptformen des Sühnemals sind das Steinkreuz und der Kreuzstein, dieser eine rechteckige oder runde Platte mit einem vertieft
oder erhaben eingemeißelten Kreuz darauf, jenes ein meist kunstlos aus Stein gehauenes Kreuz, bis zu 2 Meter hoch. Übergangsformen vom Steinkreuz zum
Kreuzstein bilden die Steinkreuze mit Armstützen. Für diese Formen braucht man keine Ableitung vom germanischen Sonnenrad, da sie sich als technische
Notwendigkeit erklären lassen.
Es ist nicht nachweisbar, ob für bestimmte Fälle Steinkreuze, für andere Kreuzsteine gesetzt wurden. Vermutlich wurde kein Unterschied
gemacht, wohl aber scheint man in einigen Gegenden die eine oder die andere Form bevorzugt zu haben.
Welche Form die ältere ist, läßt sich ebenfalls nicht entscheiden.
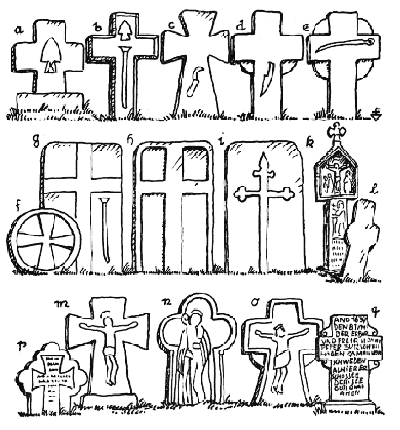 |
Tafel II: Sühnestein und Erinnerungsmal |
(Funk, Wilhelm - Alte deutsche Rechtsmale. Sinnbilder und Zeugen deutscher Geschichte. Berlin-Bremen 1940, 80-86)Literatur:
1) Aus dem großen Sonderschrifttum: E. Mogk, Der Ursprung d. mittelalt. Sühnekreuze, Berichte u. Verhandl. d. Sächs. Akad. d. Wiss., 81 (1929) Heft 1; ferner Deutsche Gaue, Kulturkunde, außerdem die Veröffentlichungen des Vereins z. Erforsch. d. Steinkreuze Nürnberg.
2) III. Buch, 1300/5
3) Karl Frölich: Arbeiten zur rechtlichen Volkskunde, Heft 1: Stätten mittelalterlicher Rechtspflege auf südwestdeutschem Boden, besonders in Hessen und den Nachbargebieten, Tübingen 1938, mit vielen Abbildungen
4) Steinkreuz 1936: Die Flurdenkmäler d. ehem. Reichsstadtgebietes
 |